Table of Contents
Einleitung: Der Wiedereintritt als thermisches Extremszenario
Die Rückkehr eines Raumfahrzeugs in die Erdatmosphäre gehört zu den thermisch anspruchsvollsten Phasen einer Mission. Beim atmosphärischen Wiedereintritt treten an der Außenseite des Fahrzeugs Temperaturen von über 1500 °C auf, verursacht durch Stoßwellen, Reibungswärme und Plasmaeffekte in der Hochatmosphäre. Gleichzeitig wirken starke mechanische Belastungen auf die Struktur. Der thermische Schutzschild (Thermal Protection System, TPS) hat dabei die Aufgabe, das Raumfahrzeug und seine inneren Komponenten vor diesen Extrembedingungen zu bewahren – idealerweise mehrfach. Die Anforderung an Wiederverwendbarkeit steht dabei zunehmend im Fokus aktueller Raumfahrtprogramme, sowohl staatlicher Agenturen wie NASA und ESA als auch privater Träger.
Während frühere Systeme auf ablative oder keramische Materialien setzten, gerät zunehmend eine Werkstoffklasse in den Blickpunkt, die folgende beiden Eigenschaften vereint: hohe mechanische Festigkeit und gute thermische Leitfähigkeit – die metallmatrixverstärkten Verbundwerkstoffe, kurz MMCs (Metal Matrix Composites). Diese Werkstoffe bestehen aus einer metallischen Matrix (z. B. Aluminium, Titan oder Nickel) mit eingebetteten keramischen Partikeln oder Fasern (z. B. SiC oder Al₂O₃), die dem Material spezifisch gewünschte Eigenschaften verleihen. Ihr Potenzial liegt insbesondere in der strukturellen Integration thermischer Schutzfunktionen, wodurch sich Gewicht, Komplexität und Kosten erheblich reduzieren lassen (Oluseyi et al., 2021).
Doch die Entscheidung, ob ein solcher Werkstoff den extremen Anforderungen eines Wiedereintritts standhält, basiert nicht allein auf theoretischen Modellannahmen oder klassischen Materialprüfungen. Die exakte Kenntnis der thermophysikalischen Eigenschaften unter realitätsnahen Bedingungen ist entscheidend – insbesondere der thermischen Diffusivität, Leitfähigkeit und Wärmekapazität über einen breiten Temperaturbereich. Hier kommt eine Methode ins Spiel, die sich in der Materialcharakterisierung für Hochtemperaturanwendungen etabliert hat: Laser Flash Analysis (LFA).
Der Laser Flash Analyzer hat sich als präzises, berührungsloses Verfahren zur Messung der thermischen Diffusivität bewährt und bildet die Grundlage für die Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit bei komplexen Materialien wie MMCs. Besonders bei anisotropen oder porösen Proben – wie sie in realen TPS-Konfigurationen vorkommen – ist die Methode besonders hilfreich. Sie ermöglicht eine aussagekräftige Bewertung der Wärmeleitung in axialer und radialer Richtung und lässt sich über große Temperaturbereiche hinweg einsetzen, was für die Bewertung von TPS-Materialien essenziell ist.
Im Rahmen dieses Artikels wird daher untersucht, wie MMCs für thermische Schutzsysteme mithilfe der Laser Flash Analyse bewertet werden können. Dabei werden aktuelle Forschungsarbeiten herangezogen, unter anderem aus der NASA-Entwicklung wiederverwendbarer metallischer TPS-Konzepte (NASA LaRC, 2004) sowie jüngste materialwissenschaftliche Studien zur Hochtemperatur-Charakterisierung von MMCs (Oluseyi et al., 2021). Im Fokus stehen nicht nur die Werkstoffeigenschaften selbst, sondern auch die messtechnischen Anforderungen und die Interpretation der LFA-Daten im Kontext realer Einsatzszenarien.
Ziel ist es, einen fundierten Einblick in die thermophysikalische Bewertung metallischer Verbundwerkstoffe für Raumfahrtanwendungen zu geben und aufzuzeigen, welchen Beitrag moderne Analyseverfahren zur Entwicklung wiederverwendbarer Hitzeschilde leisten.
Werkstofftechnische Basis: Metallmatrix-Verbundwerkstoffe als TPS-Materialien der nächsten Generation
Für thermische Schutzsysteme (TPS), die mehrfach nutzbar und gleichzeitig zuverlässig unter Extrembedingungen bleiben sollen, ist die Auswahl geeigneter Werkstoffe ein zentrales Kriterium. In der Raumfahrt dominiert dabei seit Jahrzehnten eine Spannung zwischen thermischer Isolationswirkung, mechanischer Integrität und Masseeinsparung. Metallmatrix-Verbundwerkstoffe (MMCs) bieten in dieser Hinsicht eine attraktive Alternative zu traditionellen TPS-Materialien wie Keramiken oder ablativ wirkenden Polymercomposites.
MMCs bestehen aus einer metallischen Matrix – häufig Aluminium, Titan oder Nickel – in die eine Verstärkungsphase aus keramischen Partikeln (z. B. Siliziumkarbid, Aluminiumoxid) oder kurzen Fasern eingebettet ist. Durch die gezielte Kombination beider Phasen lassen sich Eigenschaften wie die thermische Leitfähigkeit, Oxidationsstabilität, Festigkeit bei hohen Temperaturen sowie die Widerstandsfähigkeit gegen thermische Schocks auf Systemebene optimieren (Oluseyi et al., 2021).
Ein wesentliches Argument für den Einsatz von MMCs in TPS-Komponenten ist die Möglichkeit zur strukturellen Integration thermischer Funktionen. Während klassische TPS-Schichten oft zusätzlich auf eine tragende Struktur appliziert werden müssen – beispielsweise als Kacheln oder Panels –, können MMCs als lasttragendes, wärmeleitendes und thermisch dämpfendes System gleichzeitig dienen. Dies reduziert nicht nur das Gesamtgewicht, sondern erhöht auch die Wiederverwendbarkeit durch geringere Delaminations- oder Rissneigung nach wiederholtem thermischem Zyklieren.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Eigenschaften von MMCs stark vom jeweiligen Materialsystem, der Herstellungsroute und der Mikrostruktur abhängen. Aluminium-SiC-Verbundwerkstoffe etwa zeichnen sich durch eine hohe Wärmeleitfähigkeit und geringe Dichte aus, sind aber nur begrenzt oxidationsstabil oberhalb von 600 °C. Titan-basierte MMCs hingegen bieten eine exzellente Hochtemperaturstabilität bis über 1000 °C, weisen jedoch in der Verarbeitung und bei der Faser-Matrix-Anbindung größere Herausforderungen auf.
Ein vertieftes Verständnis der thermophysikalischen Eigenschaften – insbesondere der temperaturabhängigen thermischen Diffusivität und Wärmeleitfähigkeit – ist daher grundlegend, um diese Materialien gezielt für TPS-Anwendungen zu qualifizieren.
Ein weiteres Merkmal moderner MMCs ist ihre zunehmende Herstellbarkeit durch additive Fertigung, insbesondere durch Verfahren wie Laser Powder Bed Fusion (LPBF) oder Directed Energy Deposition (DED). Diese ermöglichen eine gezielte Abstimmung der lokalen Mikrostruktur sowie die Integration von graduierten Werkstoffübergängen, die thermomechanische Spannungen besser kompensieren können. In Kombination mit Methoden wie der Laser Flash Analyse lassen sich diese Werkstoffsysteme nicht nur entwickeln, sondern auch präzise prüfen und bewerten.
Im nächsten Abschnitt wird daher die messtechnische Methodik der Laser Flash Analyse (LFA) vorgestellt – und erläutert, wie sich mit ihr die entscheidenden thermophysikalischen Kennwerte von MMCs für den Hochtemperaturbereich präzise bestimmen lassen.
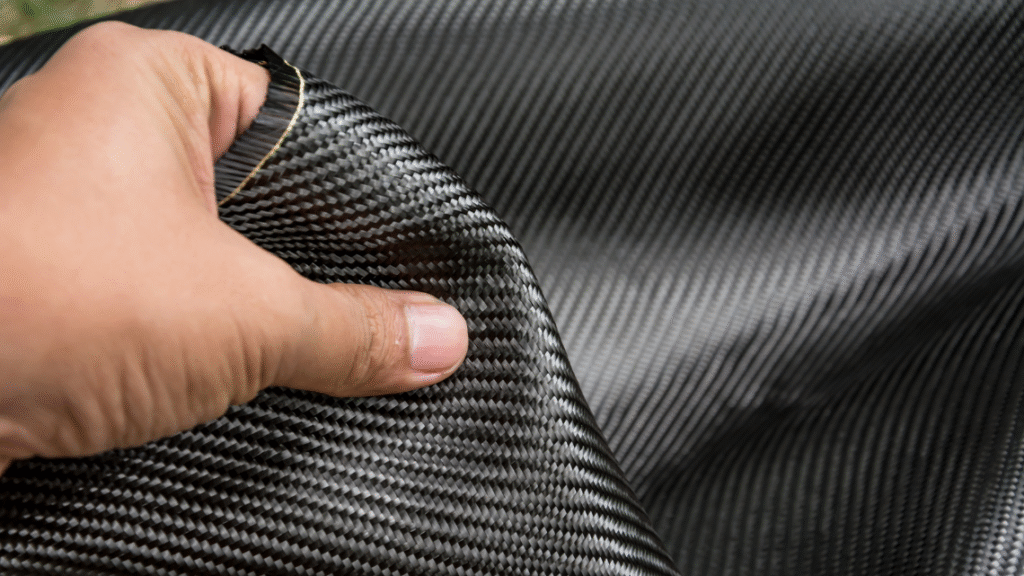
Messtechnik: Laser Flash Analysis als Schlüssel zur thermischen Charakterisierung von MMCs
Die thermische Performance eines Materials unter Hochtemperaturbedingungen hängt maßgeblich von drei Kenngrößen ab: der Wärmeleitfähigkeit (λ), der thermischen Diffusivität (α) und der spezifischen Wärmekapazität (cp). Für metallmatrixverstärkte Verbundwerkstoffe (MMCs), die bei Temperaturen über 1000 °C als thermische Schutzsysteme (TPS) fungieren sollen, ist eine präzise und materialspezifische Bestimmung dieser Eigenschaften unerlässlich. Die Laser Flash Analysis (LFA) hat sich als Standardverfahren zur Bestimmung der thermischen Diffusivität etabliert und ist besonders für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Die LFA basiert auf einem transienten, berührungslosen Messprinzip: Eine ebene Probenplatte wird auf ihrer Rückseite mit einem kurzen, hochenergetischen Laserimpuls beschossen. Die dabei entstehende Temperaturerhöhung auf der gegenüberliegenden Seite wird mit einem Infrarotsensor gemessen. Aus dem zeitlichen Verlauf dieser Temperaturantwort lässt sich die thermische Diffusivität α direkt bestimmen. Die Wärmeleitfähigkeit λ ergibt sich über die Beziehung:
\(
\lambda = \alpha \cdot \rho \cdot c_p
\quad \text{mit} \quad
\begin{cases}
\lambda : \text{Wärmeleitfähigkeit (W/m·K)} \\
\alpha : \text{Thermische Diffusivität (m$^2$/s)} \\
\rho : \text{Dichte (kg/m$^3$)} \\
c_p : \text{Spezifische Wärmekapazität (J/kg·K)}
\end{cases}
\)
Wobei ρ die Dichte und cp die spezifische Wärmekapazität des Materials ist. Diese beiden Größen können in der Regel separat bestimmt oder aus Literaturwerten bzw. ergänzenden Messverfahren wie DSC (Differential Scanning Calorimetry) herangezogen werden.
Ein zentraler Vorteil der LFA liegt darin, dass die Methode auch für komplexe, inhomogene oder anisotrope Werkstoffe genutzt werden kann, wie sie typischerweise bei MMCs vorliegen. Durch die gezielte Wahl von Probendicke, Laserenergie und Detektionszeitraum lassen sich sowohl Werkstoffe mit hoher als auch mit sehr niedriger Wärmeleitfähigkeit untersuchen. Besonders relevant ist dies für TPS-Komponenten mit Schichtaufbau oder gerichteter Mikrostruktur, bei denen die Wärmeausbreitung stark richtungsabhängig sein kann.
Hinzu kommt, dass LFA-Messungen in breiten Temperaturbereichen durchgeführt werden können – es sind Temperaturen bis 2800 °C möglich, abhängig vom Probenmaterial und der Sensorik. Dies ermöglicht eine durchgehende Analyse des Temperaturverhaltens von TPS-Materialien während verschiedener Phasen eines Wiedereintritts, vom Aufheizen durch Reibung bis zur Abkühlung in der Endflugphase.
Neben der klassischen Einzelmessung lassen sich mit der LFA auch zeit- und temperaturabhängige Verläufe, zyklische Belastungen und gezielte Alterungsuntersuchungen durchführen. Gerade im Kontext der Wiederverwendbarkeit von Raumfahrtkomponenten ist dies von großem Wert: Thermische Schädigungen wie Mikrorissbildung, Delamination oder Oxidationsangriffe äußern sich häufig in messbaren Änderungen der thermischen Diffusivität – lange bevor mechanische Tests Ausfälle detektieren.
In der praktischen Anwendung bei TPS-Entwicklungen wird die LFA deshalb nicht nur zur Werkstoffbewertung eingesetzt, sondern zunehmend auch zur Validierung numerischer Modelle (z. B. FEM oder CFD), zur Prozesskontrolle bei der Herstellung (z. B. nach additiver Fertigung) und zur Serienfreigabe hochbelasteter Komponenten.
Fallstudie: NASA-X-33 und die Entwicklung metallischer TPS mit MMCs
Im Rahmen der Entwicklung wiederverwendbarer Raumfahrtsysteme setzte die NASA Ende der 1990er Jahre mit dem X-33-Technologiedemonstrator neue Maßstäbe. Das unbemannte Testfahrzeug war Teil des größeren Reusable Launch Vehicle (RLV) Programms und sollte Technologien erproben, die einen wirtschaftlichen, voll wiederverwendbaren Zugang zum All ermöglichen. Eine der größten Herausforderungen in diesem Projekt war die Entwicklung eines robusten, leichten und wiederverwendbaren thermischen Schutzsystems (TPS) – und hier standen metallische Konzepte im Fokus, die deutlich von früheren, ablativ wirkenden Systemen abwichen (NASA LaRC, 2004).
Das sogenannte Metallic Thermal Protection System (METTPS) bestand aus mehrschichtigen Sandwichstrukturen mit oxidationsbeständigen metallischen Deckschichten, typischerweise aus Inconel- oder Titanlegierungen, auf einem thermisch isolierenden Kern (z. B. einer Wabenstruktur aus Edelstahl oder Ti). Solche Systeme bieten mehrere Vorteile: Sie lassen sich strukturintegriert ausführen, zeigen eine hohe mechanische Belastbarkeit, sind schlagzäh und können – anders als viele keramische Lösungen – bei Beschädigung segmentweise repariert werden.
Allerdings hängt die Leistungsfähigkeit dieser Systeme wesentlich von den thermophysikalischen Eigenschaften der eingesetzten Werkstoffe ab. Die präzise Kenntnis der Wärmeleitfähigkeit und der thermischen Diffusivität ist notwendig, um Temperaturverteilungen innerhalb des TPS korrekt zu modellieren, das thermomechanische Verhalten vorherzusagen und lokale Hot Spots zu vermeiden.
Das Programm identifizierte schließlich mehrere MMC-basierte Varianten mit ausreichend hoher thermischer Belastbarkeit, niedriger Delaminationsneigung und guter Wiederverwendbarkeit. Diese Systeme kombinierten die Vorteile strukturtragender Metalle mit einer kontrollierten Wärmeleitung, wodurch sie ideal für wiederholte Einsätze in suborbitalen oder orbitalen Raumfahrzeugen geeignet erschienen. Auch spätere Konzepte – etwa das TPS-System des Dream Chaser oder metallische Oberflächenverkleidungen für Hitzeschilde des Starship-Projekts – greifen auf diese Werkstoff- und Prüfphilosophie zurück.
Fazit und Ausblick: LFA als Schlüssel zur Entwicklung wiederverwendbarer Raumfahrtmaterialien
Die Entwicklung wiederverwendbarer thermischer Schutzsysteme (TPS) ist eine zentrale Herausforderung der modernen Raumfahrttechnik. Dabei rücken Werkstoffe in den Vordergrund, die sowohl hohe thermomechanische Belastbarkeit als auch strukturelle Integrierbarkeit aufweisen – Eigenschaften, die metallmatrixverstärkte Verbundwerkstoffe (MMCs) in besonderem Maße erfüllen. Ihre Hybridstruktur aus metallischer Matrix und keramischer Verstärkung erlaubt die gezielte Abstimmung von Wärmeleitfähigkeit, Festigkeit und Temperaturbeständigkeit über einen weiten Bereich. Die Auswahl geeigneter MMC-Systeme hängt jedoch entscheidend von der verlässlichen Charakterisierung ihrer thermophysikalischen Eigenschaften ab – insbesondere unter realitätsnahen Hochtemperaturbedingungen.
Die Laser Flash Analysis (LFA) hat sich in diesem Kontext als unverzichtbare Methode etabliert. Sie erlaubt nicht nur die präzise Messung der thermischen Diffusivität über große Temperaturbereiche, sondern bietet auch die Möglichkeit zur Analyse anisotroper oder komplex strukturierter Werkstoffe. Die Fähigkeit der LFA, richtungsabhängige Wärmeleitverhalten zu erfassen, insbesondere bei modernen, graduiert aufgebauten oder additiv gefertigten MMCs ist von hoher Relevanz.
Ein besonderes Potenzial ergibt sich durch die Kombination aus präziser Thermoanalyse und numerischer Simulation: LFA-Messwerte können direkt in Finite-Elemente-Modelle überführt werden, um Temperaturfelder, thermische Spannungen und Strukturverhalten unter realen Einsatzbedingungen vorherzusagen. Darüber hinaus eignet sich die Methode auch zur Qualitätsüberwachung und Alterungsanalyse wiederverwendbarer TPS-Komponenten – ein Aspekt, der angesichts zunehmend zyklisch genutzter Raumfahrtsysteme wie Starship, Dream Chaser oder Space Rider an Bedeutung gewinnt.
Zukünftige Entwicklungen könnten die Rolle der LFA weiter ausweiten. So bieten sich Perspektiven für die Inline-Charakterisierung additiv gefertigter MMCs in industriellen Prozessen, etwa durch miniaturisierte LFA Systeme mit optischer Pulserzeugung und IR-Detektion im Bauraum. Auch die Kopplung mit Thermogravimetrie (TGA), Dilatometer (DIL) und Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) zur simultanen Bestimmung von cp und Dichtewerten verspricht eine höhere Genauigkeit bei der Ableitung der Wärmeleitfähigkeit.
Im Rahmen digitaler Werkstoffentwicklung – etwa durch den Einsatz digitaler Zwillinge oder KI-gestützter Materialmodelle – stellen LFA-Daten eine essenzielle Grundlage für die datenbasierte Auswahl und Optimierung zukünftiger TPS-Materialien dar. Damit trägt die Methode nicht nur zur experimentellen Validierung bestehender Designs bei, sondern ermöglicht auch die gezielte Entwicklung neuer Werkstoffkonzepte im virtuellen Raum.
Die Kombination aus innovativen Werkstoffen wie MMCs, präziser Charakterisierung durch LFA und intelligentem Simulationsdesign verspricht somit einen nachhaltigen Fortschritt in der Entwicklung wiederverwendbarer Raumfahrtsysteme – mit direktem Nutzen für Performance, Kosten und Sicherheit künftiger Missionen.
Quellenverzeichnis
Oluseyi P. Oladijo et al. (2021). HighTemperature Properties of Metal Matrix Composites. In: Encyclopedia of Materials: Composites. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819724-0.00096-3
NASA Thermal Protection Materials Branch. (2023). Testing and fabrication of TPS materials: use of Laser Flash Analysis (LFA). NASA Website. https://www.nasa.gov/thermal-protection-materials-branch-testing-and-fabrication/?utm_source=chatgpt.com